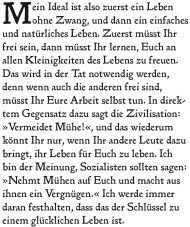… es sollte nicht vorschnell als nur die Oberfläche der Dinge betreffend oder nach Geschmack betrachtet werden. Der Designtheoretiker Heinz Hirdina ging dieser Frage in der Tiefe nach.
Wir geben hier einen Auszug aus einer Vorlesung wieder, die Heinz Hirdina (1942 -2013) als Hochschullehrer an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gehalten hat. Ganz nachzulesen ist das in:
Figur und Grund
Entwurfshaltungen im Design von William Morris bis Buckminster Fuller
Vorlesungen von Heinz Hirdina, Band 1, herausgegeben für die Stiftung Bauhaus Dessau, 2020
Sie haben an den Arbeiten von Morris gesehen, dass im Zentrum seines Denkens und Entwerfens das Ornament steht. Meine These dazu ist, dass es ihm nicht um das Ornament ging, sondern um zwei andere Ziele: Das eine liegt im Charakter der Arbeit, das andere in der Vorstellung von Umwelt. Die Veränderung der Arbeit wird zum Ziel, weil erst das Ornament das Arbeiten zu einer Freude macht. Die Umwelt wird zum Ziel, weil Morris nach einer Harmonie von Natur und Kunst, von Wachsen und Gestalten sucht. Solche Harmonie stiftet das Ornament.
Damit lassen sich drei Fragen stellen: Was überhaupt ist das Ornament? Wie kommt man zu dieser Einheit von Natur und Kultur? Warum ist Arbeitsfreude nur im Dekorieren möglich?
Zunächst zum Ornament. Begriffsgeschichtlich kommt das Wort Ornament vom Verb ornare, und zwar in der Doppelbedeutung von „ausschmücken“ und „ausrüsten“, zum Beispiel ein Schiff oder einen Würdenträger, der erst mit dem Ornat eine Autorität darstellt. Als „ausschmücken“ geht es auf die antike Rhetorik zurück, und damit schon auf eine ambivalente Deutung des Ornaments. Denn was eine Rede ausschmückt, muss nicht nur unterhaltend und überzeugend sein, es kann als äußerliches Ausschmücken auch ablenkend, überredend und somit manipulativ eingesetzt werden. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung auf „ausschmücken“ reduziert, und übrig geblieben ist das dekorative Ornament.
Das Ornament hat bei Morris mehrere Bedeutungen. Es ist die verzierte Oberfläche des Gegenstands, es ist die Form des Gegenstands, es ist die Gestalt der Natur, und es ist der kulturelle Überbau einer ökonomischen Praxis.
Dazu etwas genauer: Wenn er mit dem Ornament eine verzierte Oberfläche meint, steckt er tief im 19. Jahrhundert, aber von da startet er in die Utopie. Dieses Jahrhundert befand sich in jener Tradition – Sie haben das schon gehört –, die im Florenz des 16. Jahrhunderts mit einem anderen Anspruch begann und sich schließlich auf das Dekorieren von Gebrauchsgegenständen reduzierte. Aber Morris geht weiter, denn das Schmücken hat für ihn eine menschheitsgeschichtliche Dimension. Wegen dieser Dimension wird das Ornament identisch mit der Form. Das heißt, das Ornament ist nicht auf die Oberfläche appliziert, sondern die Form der Dinge selbst ist ornamental. In dem Vortrag „Die geringeren Künste“ von 1877 heißt es: „[…] denn es gibt kaum irgendetwas, was die Allgemeinheit benutzt und was wir [Handwerker) formen, das nicht stets als unfertig empfunden wurde, bis es die eine oder andere Spur von Dekoration an sich hatte.“
Bei Morris findet sich ein interessantes Verhältnis zwischen dem Ornament und dem Träger des Ornaments, zwischen einem Objekt und seiner Oberfläche.
Ganz allgemein kann man sich auf dreierlei Weise zu Oberflächen verhalten: Erstens kann man sie als das Eigentliche nehmen. Darunter befindet sich nichts – kein Wesen, kein Kern, keine Funktion, keine Struktur. Das alles ist die Oberfläche selbst. Das ist geschichtlich zum ersten Mal so in der Postmoderne artikuliert worden. In ihr ist alles Oberfläche.
Zweitens kann man die Oberfläche weitgehend negieren und stattdessen nach Funktion, Raum, Strukturen und Beziehungen fragen. Das ist das Verfahren der Moderne im Allgemeinen und des Funktionalismus im Besonderen.
Ein Beispiel: Der Putz der Bauhausfassade war in den vergangenen Jahren Gegenstand sehr teurer und aufwendiger Analysen, weil man den Originalzustand wiederherstellen wollte. Das ist nach meinem Dafürhalten reine Geldverschwendung, weil es dem Bauhaus nicht auf den Putz, sondern auf den Raum dahinter ankam. Das Bauhaus war nicht materialästhetisch orientiert.
Die dritte Möglichkeit nun verkörpert Morris. Er besteht auf einer schönen Oberfläche. Etwas, was sozial und moralisch gut sein soll im Sinne von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, muss auch gut aussehen. Was nicht gut aussieht, kann auch nicht gut sein. Oskar Negt hat deshalb gemutmaßt, dass Morris die heruntergekommenen Städte in der DDR wohl schwer im Magen gelegen hätten.
Für dieses gute Aussehen war bei Morris das Ornament verantwortlich. Das Ornament ist für ihn nicht der schöne Schein eines Dings, sondern dessen Schönheit selbst. Es geht bei Morris noch weiter, denn Ornament ist nicht nur die Form eines menschengemachten Gegenstands, sondern auch die Natur ist ornamental, das heißt, das Ornament beginnt nicht erst mit der menschlichen Geschichte, sondern mit der Entwicklung der Naturformen. Morris beschreibt diese Naturformen als wunderbare, komplizierte Muster, die ineinander verwoben sind.
Und nach der Natur wird auch die Kultur ornamental: Er bezeichnet Kultur als den ornamentalen Schmuck des Lebens. Hier hat ornare wieder die Bedeutung von „ausschmücken“: Für die nackte biologische Existenz ist Kultur nicht unbedingt notwendig, wohl aber für die soziale Existenz des Menschen. In diesem Verständnis des nicht Notwendigen, aber auch nicht Überflüssigen, sind Wissenschaft, Kunst und andere Vergnügungen Ornamente des Lebens.
Die Welt ist damit bei Morris ornamental verfasst. Und er denkt über Ornamente nach, weil er die Welt verändern will. Dem stehen jedoch viele Widerstände entgegen, vor allem die auf Profit orientierte Wirtschaft, die er als Kommerz bezeichnet, aber auch das Banausentum seiner Zeitgenossen.
Weil die Verzierungen überall zu sehen sind, erscheinen sie ihren Betrachtern wie ein Naturprodukt, das sie nicht weiter beachten.“Um so schlimmer!“, meint Morris, denn dann sind die Augen abgestumpft. Die Funktion des Ornaments sieht Morris gerade darin, „unsere abgestumpften Sinne […] zu schärfen“. Dies sei „einer der Hauptzwecke der Verzierung und die Hauptrolle in ihrem Bündnis mit der Natur“. Für seine Gegenwart sieht er Ornamente nur in ihrer Funktion, das Kaufen zu beschleunigen und anzuheizen, in der Zukunft dagegen ist das Ornament Träger geschichtlicher und aktueller Bedeutungen. Das heißt, Ornamente vermitteln bei ihm zwischen der Gesellschaft und dem Individuum, das sich im Ornament seiner sozialen und geschichtlichen Existenz bewusst wird – und ebenso seiner natürlichen Existenz.
Wie kommt man also mittels der Ornamente zur Harmonie zwischen Natur und Kultur? Nicht dann jedenfalls, wenn die Abhängigkeit von der Natur geleugnet wird, dann werden die Formen hässlich: „Denn […] alles von Menschenhand Geschaffene besitzt eine Form, entweder eine schöne oder eine häßliche: eine schöne, wenn sie mit der Natur in Einklang steht […]; eine häßliche, wenn sie mit der Natur nicht übereinstimmt und deren Harmonie verletzt.“ Morris ruft dazu auf, es wie die Natur zu machen, ohne die Natur zu imitieren. Vom Hervorbringen komplizierter und wunderbarer Muster her entwirft Morris ein Bild von der Zukunft des Menschen in Harmonie mit der Natur: „[…] bei ihrer Schöpfung wird der Handwerker dazu angeleitet, in derselben Weise zu wirken wie die Natur, bis das Gewebe, der Becher oder das Messer so natürlich, ja so schön aussieht wie die Wiese, das Flussufer oder der Bergkiesel.“
Drei Ziele also hat das Ornamentieren bis hierher: Dem Betrachter soll es die Sinne wachhalten, durch das Ornament soll das Menschengemachte so schön werden wie die Natur. Und schließlich: Im Ornament soll sich der Betrachter als soziales und natürliches Wesen erfahren. Wer solcherart Ornamente hervorbringt, ist also Handwerker, denn das Kunsthandwerk seiner Zeit beschreibt Morris als trivial, mechanisch, geistlos und ins modisch Verlogene abgeglitten. So sind dann auch die Ornamente. Warum aber ist Arbeitsfreude nur durch das Dekorieren möglich? Die von Morris vorgestellte Arbeit vereinigt das Ausführen mit dem Entwerfen. Diese Einheit von Entwerfen und Ausführen macht die Arbeit zur Freude, und diese Freude wiederum ist an das Ornament gebunden, weil das Ornament etwas Ganzes ist. Im Ornament sieht sich sein Schöpfer als ein Ganzer an, einer, der nicht durch Arbeitsteilung fragmentiert und zersplittert ist. Eine andere wünschenswerte Zukunft kann sich Morris daher nur ornamental denken.
Adolf Loos bringt 1909 das Ornament seiner Zeit mit potenziellen Verbrechen in Beziehung, der Philosoph Lothar Kühne, Vertreter der Berliner Ästhetik, sieht darin 1981 die Poesie der Erinnerung, Morris dagegen verbindet es mit einer Utopie, die eine soziale Utopie ist, und als soziale Utopie hat sie eine kommunistische Perspektive. Heißt das nun, dass für Morris das Ornament kommunistisch ist, oder plädiert er für einen ornamentalen Kommunismus? Ich will mich der Antwort über einen Umweg nähern, über John Ruskin und seine Ornamentauffassung.
Schon Ruskin unterscheidet die Ornamente nicht danach, wie sie aussehen – also ob es florale, animalische, anthropomorphe oder geometrische Ornamente sind –, sondern danach, durch welche Art von Arbeit sie entstehen. So kommt er zu einer sklavischen, zu einer konstitutionellen und zu einer revolutionären Ornamentik. Nachzulesen ist das in der schon erwähnten Schrift „Das Wesen der Gotik“, die vom Beginn der 1850er-Jahre stammt und zu seinem Buch Die Steine von Venedig gehört.
Das sklavische Ornament entsteht, wenn der Entwerfende wie ein unnahbarer Gott über dem Ausführenden thront, wenn die Entwurfskompetenz die Ausführungskompetenz dominiert, wenn der Ausführende nur realisieren darf, was der Gestalter entworfen hat. Dem Ausführenden bleibt keinerlei Gestaltungsspielraum.
So entstehen zwar vollkommene Ornamente, aber sie sind tot, weil sie zwar alle Spuren des Entwerfenden, aber keine des Ausführenden tragen, außer denen des Ausführens selbst.
Das konstitutionelle Ornament entsteht, wenn sich der Ausführende einem Gesamtplan unterordnet, den es für eine Werkstatt, ein Bauwerk, usw. gibt. Der Ausführende erkennt also freiwillig eine Kompetenz über ihm an. Er hat einen gewissen Gestaltungsspielraum, der sich in Abweichungen vom Muster ausdrückt oder dem gar kein Muster zugrunde liegt, sondern nur die Aufforderung nach ornamentalem Schmuck zu einem vorbestimmten Thema. Das macht die ehemals vollkommenen Ornamente unvollkommen. Aber gerade diese Unvollkommenheit ist gottgefällig, weil sie menschlich ist, denn nur Gott ist vollkommen.
Das revolutionäre Ornament unterscheidet sich von seinen Vorgängern deutlich: Ornament ist nicht mehr nur die Verzierung des Gegenstands, sondern der Gegenstand selbst. Ähnlich wie bei Morris sind Ornament und Gegenstand identisch. Ruskin beurteilt solcherart Ornamente nach Ressourcenverbrauch und praktischer Brauchbarkeit. Für diese Ornamente formuliert er drei Regeln: Erstens soll niemand zur Herstellung von Dingen ermuntert werden, die nicht notwendig sind und die in ihrer Produktion keine Erfindung notwendig machen; er denkt sie also doppelt, vom Gebrauch her und von der Produktion her. Bezogen auf den Gebrauch sollen sie keine Verschwendung von Ressourcen darstellen, bezogen auf die Produktion keine geistlose Routine zulassen. Zweitens soll niemand verlangen, dass ein Material mit Vollkommenheit verarbeitet wird. Dafür gibt es nur zwei Ausnahmen: Wenn die absolute Perfektion ein praktisches Ziel hat oder in der Kunst ein erhabenes Ziel. Hier haben Sie das für Ruskin charakteristische Programm des Menschlichen als des Unvollkommenen. Drittens soll niemand zum Nachahmen oder Kopieren ermuntern – es sei denn, große Werke sollten als Zeugnisse erhalten werden. Man könnte solche Kopien quasi als Sicherungskopien bezeichnen. Das revolutionäre Ornament erlaubt also keine Verschwendung, keine unangemessene Perfektion und keine unnötigen Kopien.
Was die Freude beim Ornamentieren sowohl bei Ruskin als auch bei Morris ausmacht, könnte man als Wahl- und Entscheidungsfreiheit beschreiben: als Freiheit, über die Formen des Ornaments, über die Werkzeuge, über die Technologien mitbestimmen oder bestimmen zu können und schließlich auch noch über die Ergebnisse mitverfügen zu können.